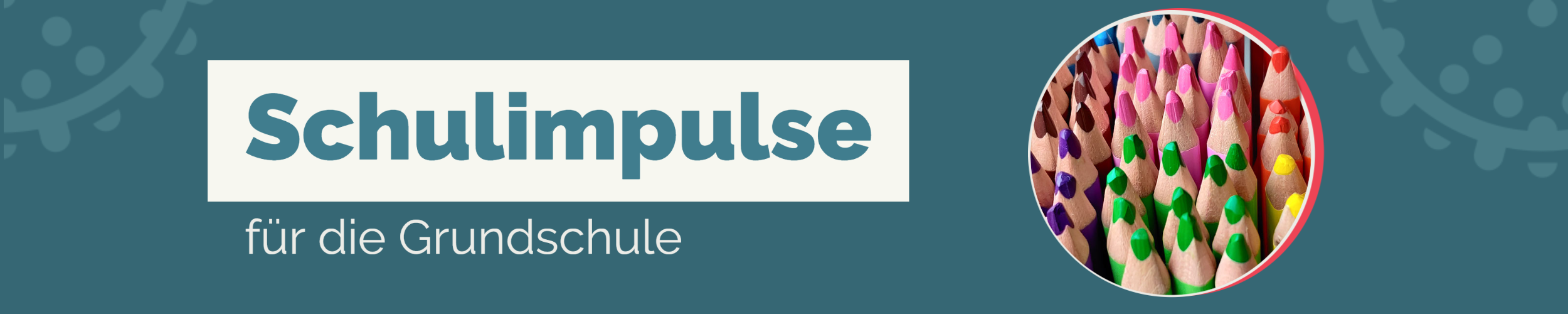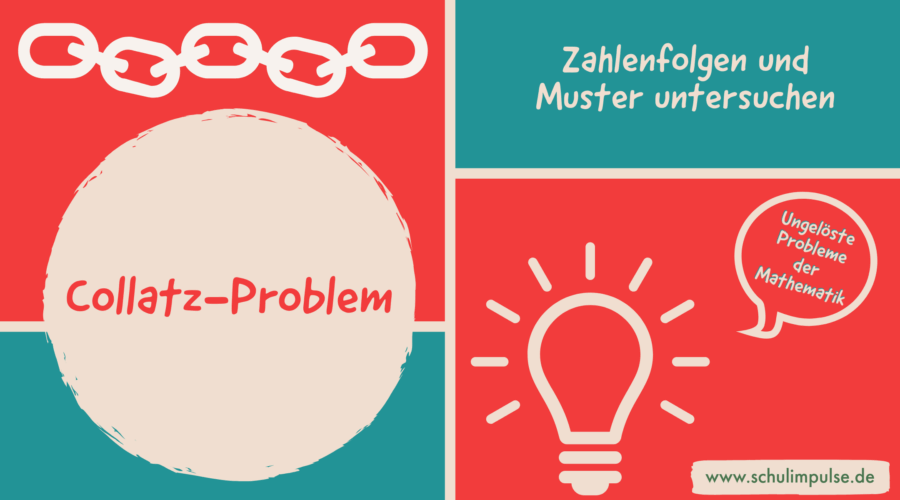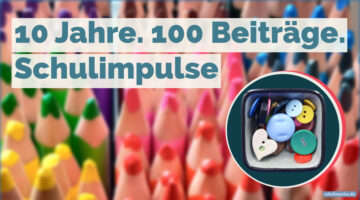Ungelöste Probleme der Mathematik als Übungsformate: Das Collatz-Problem (3n+1)
In der Beitragsreihe „Ungelöste Probleme der Mathematik als Übungsformate“ werden Beispiele vorgestellt, die zeigen, wie sich große mathematische Fragen kindgerecht im Unterricht aufgreifen lassen. Dieser Beitrag widmet sich dem Collatz-Problem. Der erste Teil der Reihe beschäftigt sich mit den Goldbachschen Vermutungen.
Im Jahr 2000 veröffentlichte das „Clay Mathematics Institute“ (CMI) in den USA eine Übersicht über sieben bisher ungelöste Problemstellungen der Mathematik. Diese Millenium-Probleme basieren u.a. auf Überlegungen des Mathematikers David Hilbert aus dem Jahr 1900, der 23 zum damaligen Zeitpunkt unbewiesene mathematische Probleme zusammengestellt hat.
Die Auseinandersetzung mit diesen „Hilbertschen Problemen“ hat die Mathematik als Wissenschaft im 20. Jahrhundert geprägt (vgl.→ Kaprekar-Konstante) und steht exemplarisch für die fortwährende Suche nach Lösungen für offene Fragen der Mathematik. Dabei geht es nicht zuletzt um das Entdecken und Beschreiben von Mustern und Strukturen.
In didaktisch reduzierter Form können solche Fragestellungen rund um Zahlbeziehungen, Muster und Strukturen bereits in der Grundschule aufgegriffen werden. Sie fördern ein mathematisches Denken, das weit über das bloße Rechnen hinausgeht.
Ein Beispiel dafür ist das Collatz-Problem, das verdeutlicht, wie aus einer leicht nachvollziehbaren Rechenregel komplexe Zahlenfolgen entstehen, mit denen sich sowohl Mathematikerinnen und Mathematiker als auch Kinder im Unterricht der Grundschule beschäftigen können.
Das Collatz-Problem

Das Collatz-Problem stammt vom Mathematiker Lothar Collatz, der u.a. bei David Hilbert und Erwin Schrödinger (→ quantenmechanisches Gedankenexperiment „Schrödingers Katze“) studiert hat.
Sein bisher ungelöstes Problem lässt sich unkompliziert nachvollziehen und eignet sich daher als Übungsformat im Mathematikunterricht der Grundschule – auch wenn es in der Mathematik von heute als nicht beweisbar gilt.
Bildungsvorschrift für Zahlenfolgen des Collatz-Problems, auch (3n+1)-Problem genannt:
Ausgangspunkt ist eine Zahl n > 0
ist n gerade, so gilt n : 2
ist n ungerade, so gilt 3n + 1
mit der Ergebniszahl wird so immer weiter verfahren
Wenn als Startzahl beispielsweise n = 7 gewählt wird, entsteht aus den Ergebnissen die Zahlenfolge:
7 → 22 → 11 → 34 → 17 → 52 → 26 → 13 → 40 → 20 → 10 → 5 → 16 → 8 → 4 → 2 → 1
Beispiel für das Vorgehen (zur Veranschaulichung). Die Darstellung zeigt exemplarisch, wie die Zahlenfolge entsteht und welche Denkprozesse dabei ablaufen.
Schritt 1: Startzahl 7
| Schritt | Zahl n | Regel | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 2 | 7 | ungerade → 3 · 7 + 1 | 22 |
| 3 | 22 | gerade → 22 : 2 | 11 |
| 4 | 11 | ungerade → 3 · 11 + 1 | 34 |
| 5 | 34 | gerade → 34 : 2 | 17 |
| 6 | 17 | ungerade → 3 · 17 + 1 | 52 |
| 7 | 52 | gerade → 52 : 2 | 26 |
| 8 | 26 | gerade → 26 : 2 | 13 |
| 9 | 13 | ungerade → 3 · 13 + 1 | 40 |
| 10 | 40 | gerade → 40 : 2 | 20 |
| 11 | 20 | gerade → 20 : 2 | 10 |
| 12 | 10 | gerade → 10 : 2 | 5 |
| 13 | 5 | ungerade → 3 · 5 + 1 | 16 |
| 14 | 16 | gerade → 16 : 2 | 8 |
| 15 | 8 | gerade → 8 : 2 | 4 |
| 16 | 4 | gerade → 4 : 2 | 2 |
| 17 | 2 | gerade → 2 : 2 | 1 |
Durch das regelbasierte Multiplizieren, Addieren und Dividieren eignet sich das Collatz-Problem als Übungsformat ab Klasse 3 oder als „warm up“ für den Unterrichtseinstieg.
Mit einem Blick auf das Ende der Zahlenfolge können Lehrpersonen oder Lernende schnell überprüfen, ob die Rechenschritte korrekt ausgeführt worden sind: Denn Collatz Vermutung lautet, dass jede so erzeugte Zahlenfolge mit dem Zyklus 4, 2, 1 endet – dass also jede Zahlenfolge in einer unendlichen Schleife dieser drei Zahlen mündet.
Beweisbar ist die Vermutung mit mathematischen Mitteln bis heute nicht, dennoch stehen am Ende jeder in der Schule überprüfbaren Zahlenfolge die Zahlen 4, 2, 1.
Arbeitsaufträge
- Wähle eine beliebige Zahl, die größer als 0 ist, als Startzahl.
- Wenn deine Zahl gerade ist, dann teile sie durch 2.
- Wenn deine Zahl ungerade ist, dann multipliziere sie mit 3 und addiere 1.
- Setze auf diese Weise mit der Ergebniszahl fort.
Weiterführende Arbeitsaufträge zur Differenzierung
- Was stellst Du fest? Beschreibe. Warum ist das so? Begründe. (→vgl. Lernumgebungen)
- Notiere die Zahlenfolgen für alle Startzahlen zwischen 1 und 10.
- Notiere die Zahlenfolgen für alle Startzahlen zwischen 11 und 20.
- Untersuche die Zahlenfolgen. Beschreibe. Was stellst Du fest?
- Untersuche weitere Startzahlen und ihre Zahlenfolgen.
- Erfinde eine eigene Bildungsvorschrift für eine Zahlenfolge. Probiere sie aus. Sprich mit Deinen Mitschülerinnen und Mitschülern darüber.
Übersicht über Zahlenfolgen des Collatz-Problems von 1 bis 24:
| Zahlenfolge | Anzahl der Zahlen der Zahlenfolge |
| 1 → 4 → 2 → 1 | 4 |
| 2 → 1 → 4 → 2 → 1 | 5 |
| 3 → 10 → 5 → 16 → 8 → 4 → 2 → 1 | 8 |
| 4 → 2 → 1 | 3 |
| 5 → 16 → 8 → 4 → 2 → 1 | 6 |
| 6 → 3 → 10 → 5 → 16 → 8 → 4 → 2 → 1 | 9 |
| 7 → 22 → 11 → 34 → 17 → 52 → 26 → 13 → 40 → 20 → 10 → 5 → 16 → 8 → 4 → 2 → 1 | 17 |
| 8 → 4 → 2 → 1 | 4 |
| 9 → 28 → 14 → 7 → 22 → 11 → 34 → 17 → 52 → 26 → 13 → 40 → 20 → 10 → 5 → 16 → 8 → 4 → 2 → 1 | 20 |
| 10 → 5 → 16 → 8 → 4 → 2 → 1 | 7 |
| 11 → 34 → 17 → 52 → 26 → 13 → 40 → 20 → 10 → 5 → 16 → 8 → 4 → 2 → 1 | 15 |
| 12 → 6 → 3 → 10 → 5 → 16 → 8 → 4 → 2 → 1 | 10 |
| 13 → 40 → 20 → 10 → 5 → 16 → 8 → 4 → 2 → 1 | 10 |
| 14 → 7 → 22 → 11 → 34 → 17 → 52 → 26 → 13 → 40 → 20 → 10 → 5 → 16 → 8 → 4 → 2 → 1 | 18 |
| 15 → 46 → 23 → 70 → 35 → 106 → 53 → 160 → 80 → 40 → 20 → 10 → 5 → 16 → 8 → 4 → 2 → 1 | 18 |
| 16 → 8 → 4 → 2 → 1 | 5 |
| 17 → 52 → 26 → 13 → 40 → 20 → 10 → 5 → 16 → 8 → 4 → 2 → 1 | 13 |
| 18 → 9 → 28 → 14 → 7 → 22 → 11 → 34 → 17 → 52 → 26 → 13 → 40 → 20 → 10 → 5 → 16 → 8 → 4 → 2 → 1 | 21 |
| 19 → 58 → 29 → 88 → 44 → 22 → 11 → 34 → 17 → 52 → 26 → 13 → 40 → 20 → 10 → 5 → 16 → 8 → 4 → 2 → 1 | 21 |
| 20 → 10 → 5 → 16 → 8 → 4 → 2 → 1 | 8 |
| 21 → 64 → 32 → 16 → 8 → 4 → 2 → 1 | 8 |
| 22 → 11 → 34 → 17 → 52 → 26 → 13 → 40 → 20 → 10 → 5 → 16 → 8 → 4 → 2 → 1 | 16 |
| 23 → 70 → 35 → 106 → 53 → 160 → 80 → 40 → 20 → 10 → 5 → 16 → 8 → 4 → 2 → 1 | 16 |
| 24 → 12 → 6 → 3 → 10 → 5 → 16 → 8 → 4 → 2 → 1 | 11 |
Hinweise und typische Muster
- Es wird vermutet, dass jede Folge unabhängig von der Startzahl irgendwann in den Zyklus 16 → 8 → 4 → 2 → 1 (und damit in die Endschleife 4 → 2 → 1 → 4 → 2 → 1 …) mündet. Bewiesen werden konnte das bis heute allerdings noch nicht.
- Zwischen der Startzahl und der Länge der Zahlenfolge besteht kein unmittelbar erkennbarer Zusammenhang. Beim Erkunden begegnen Kindern jedoch Auffälligkeiten wie „Gerade Startzahlen halbieren sich sofort. Die Länge ihrer Zahlenfolge wirkt dadurch kürzer“ oder „Ungerade Startzahlen werden zuerst größer. Ihre Zahlenfolge erscheint dadurch länger“. Die Allgemeingültigkeit dieser Beobachtungen konnte bisher allerdings nicht bewiesen werden.
- Unterschiedliche Startzahlen können gleiche Teil-Zahlenfolgen enthalten. Kinder entdecken darin wiederkehrende Muster und Strukturen. Für eine ungerade Startzahl gilt: Wird diese verdoppelt, enthält die neue Zahlenfolge deren Zahlenfolge. Beispiel: Die Zahlenfolge der ungeraden Startzahl 3 → 10 → 5 → 16 → 8 → 4 → 2 → 1 ist in der Zahlenfolge der verdoppelten Startzahl 6 → 3 → 10 → 5 → 16 → 8 → 4 → 2 → 1 vollständig enthalten.
- Bei geraden Zahlen wird die Regel n : 2 so oft wiederholt, bis eine ungerade Zahl erreicht ist. Dadurch können Blöcke von aufeinanderfolgenden Halbierungen entstehen, z.B. 24 → 12 → 6 → 3 oder 16 → 8 → 4 → 2 → 1.
- Eine ungerade Startzahl wird durch die Regel 3n + 1 sofort gerade. Diese wird anschließend so oft halbiert, bis wieder eine ungerade Zahl entsteht.
Bezug zu den Bildungsstandards
vgl. Bildungsstandards für das Fach Mathematik Primarbereich (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 15.10.2004)
inhaltsbezogene und allgemeine mathematische Kompetenzen
Problemlösen
- mathematische Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten bei der Bearbeitung problemhaltiger Aufgaben anwenden,
- Lösungsstrategien entwickeln und nutzen (z.B. systematisch probieren),
- Zusammenhänge erkennen, nutzen und auf ähnliche Sachverhalte übertragen.
Zahlen und Operationen
- Zahldarstellungen und Zahlbeziehungen verstehen
- Rechenoperationen verstehen und beherrschen
Muster und Strukturen
- Gesetzmäßigkeiten erkennen, beschreiben und darstellen
- Gesetzmäßigkeiten in geometrischen und arithmetischen Mustern (z.B. in Zahlenfolgen oder strukturierten Aufgabenfolgen) erkennen, beschreiben und fortsetzen,
- arithmetische und geometrische Muster selbst entwickeln, systematisch verändern und beschreiben.
Andreas Grajek
Letzte Aktualisierung: 25. Oktober 2025