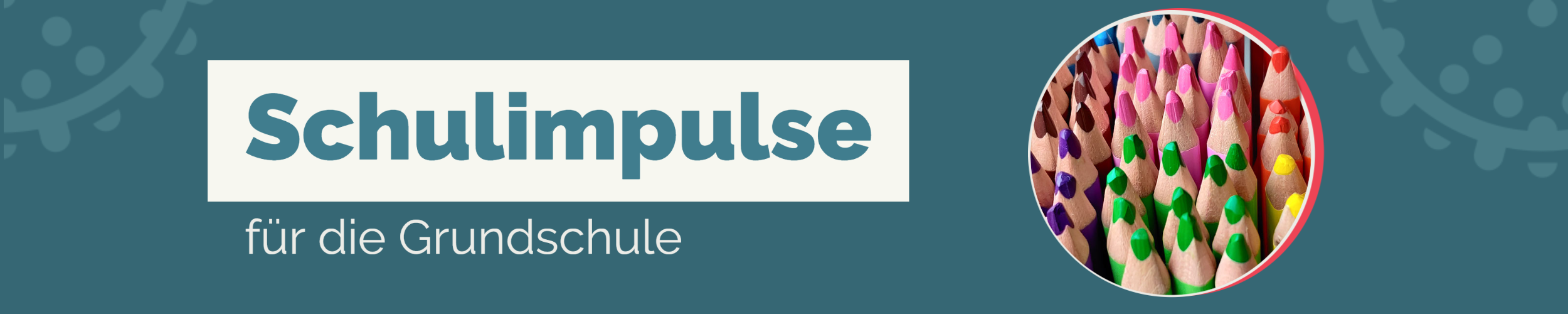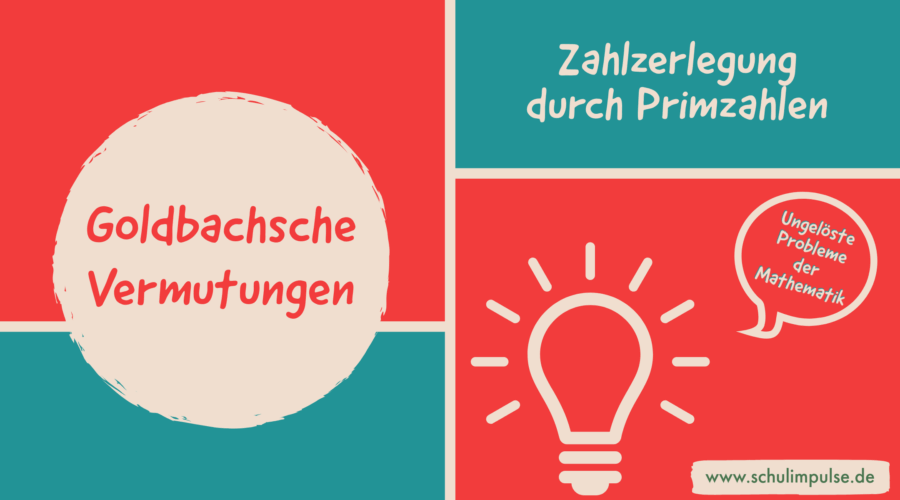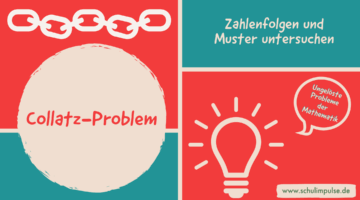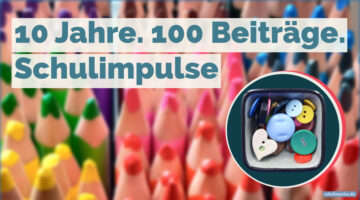Ungelöste Probleme der Mathematik als Übungsformate: Die Goldbachschen Vermutungen
In der Beitragsreihe „Ungelöste Probleme der Mathematik als Übungsformate“ werden Beispiele vorgestellt, die zeigen, wie große mathematische Fragen kindgerecht im Unterricht aufgegriffen werden können. Dieser Beitrag widmet sich der Goldbachschen Vermutung. Der zweite Teil der Reihe beschäftigt sich mit dem Collatz-Problem (3n+1).
Im Jahr 2000 veröffentlichte das „Clay Mathematics Institute“ (CMI) in den USA eine Übersicht über sieben bisher ungelöste Problemstellungen der Mathematik. Diese Millenium-Probleme basieren u.a. auf Überlegungen des Mathematikers David Hilbert aus dem Jahr 1900, der 23 zum damaligen Zeitpunkt unbewiesene mathematische Probleme zusammengestellt hat.
Die Auseinandersetzung mit diesen „Hilbertschen Problemen“ hat die Mathematik als Wissenschaft im 20. Jahrhundert geprägt und steht exemplarisch für die fortwährende Suche nach Lösungen für offene Fragen der Mathematik. Dabei geht es nicht zuletzt um das Entdecken und Beschreiben von Mustern und Strukturen (vgl.→ Kaprekar-Konstante).
In didaktisch reduzierter Form können solche Fragestellungen rund um Zahlbeziehungen, Muster und Strukturen bereits in der Grundschule aufgegriffen werden. Sie fördern ein mathematisches Denken, das weit über das bloße Rechnen hinausgeht.
Ein Beispiel dafür ist die Goldbachsche Vermutung, die bereits in der Grundschule dazu einlädt, mit einfachen Zahlzerlegungen Primzahlen und Zahlbeziehungen zu untersuchen.
Die Goldbachschen Vermutungen

Zu den um 1900 ungelösten Fragen der Mathematik zählt die „starke Goldbachsche Vermutung“, welche nach einem Beweis für die Aussage sucht, dass sich jede Zahl, die größer als 2 ist, als Summe von zwei Primzahlen darstellen lässt. Die Gültigkeit der Aussage ist kaum zu beweisen – ihre Ungültigkeit allerdings auch nicht.
Eine abgeschwächte und wahrscheinlich leichter zu beweisende Variante der Vermutung besteht in der Aussage, dass sich jede ungerade Zahl, die größer als 5 ist, als Summe von drei Primzahlen darstellen lässt.
Sowohl die starke als auch die schwache Goldbachsche Vermutung lassen sich für den Mathematikunterricht der Grundschule als Übungsformate adaptieren (vgl. → Zehnerfreunde, Zahlenplakate, Pinnwand).
Durch Aufgaben, die zum Probieren und systematischen Probieren anregen, werden zentrale prozessbezogene Kompetenzen wie Problemlösen und Argumentieren entwickelt (→ vgl. Sachaufgaben, schriftliche Subtraktion).
Übrigens: In der Zeit von Christian Goldbach, der im 18. Jahrhundert lebte, galt die 1 gelegentlich noch als Primzahl. Heute besteht in der Mathematik Einvernehmen darüber, dass die Zahl 2 die kleinste Primzahl ist. Dementsprechend sind Primzahlen definiert als natürliche Zahlen größer als 1, die nur durch 1 und sich selbst teilbar sind. Eine Primzahl hat also genau zwei Teiler, was auf die 1 nicht zutrifft.
Starke Goldbachsche Vermutung
Jede gerade Zahl größer als 2 ist Summe zweier Primzahlen.
Beispiele:
4 = 2 + 2
6 = 3 + 3
8 = 3 + 5
10 = 5 + 5
12 = 5 + 7
14 = 7 + 7 und 14 = 3 + 11
usw.
Arbeitsaufträge und Differenzierungspotenzial
- Wähle eine gerade Zahl, die größer als 2 ist. Finde zwei Primzahlen, deren Summe deine Zahl ergibt.
- Notiere für gerade Zahlen im Zahlenraum bis 100 Gleichungen, deren Summanden zwei Primzahlen sind.
- Einige gerade Zahlen lassen sich nicht nur durch eine einzige Gleichung darstellen. Notiere zu diesen Zahlen weitere Möglichkeiten, diese als Summe von zwei Primzahlen darzustellen.
- Probiere auch gerade Zahlen aus, die größer als 100 sind.

Schwache Goldbachsche Vermutung
Jede ungerade Zahl größer als 5 ist Summe dreier Primzahlen.
Beispiele:
7 = 2 + 2 + 3
9 = 2 + 2 + 5 oder 9 = 3 + 3 + 3
11 = 3 + 3 + 5 oder 11 = 2 + 2 + 7
13 = 3 + 5 + 5
15 = 3 + 5 + 7 oder 15 = 5 + 5 + 5 oder 15 = 2 + 2 + 11
usw.
Arbeitsaufträge und Differenzierungspotenzial
- Wähle eine ungerade Zahl, die größer als 5 ist. Finde drei Primzahlen, deren Summe deine Zahl ergibt.
- Notiere für ungerade Zahlen von 7 bis 99 Gleichungen, deren Summanden drei Primzahlen sind.
- Einige ungerade Zahlen lassen sich nicht nur durch eine einzige Gleichung darstellen. Notiere zu diesen Zahlen weitere Möglichkeiten, diese als Summe von drei Primzahlen darzustellen.
- Probiere auch ungerade Zahlen aus, die größer als 99 sind.
Bezug zu den Bildungsstandards
vgl. Bildungsstandards für das Fach Mathematik Primarbereich (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 15.10.2004)
inhaltsbezogene und allgemeine mathematische Kompetenzen
Problemlösen
- mathematische Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten bei der Bearbeitung problemhaltiger Aufgaben anwenden,
- Lösungsstrategien entwickeln und nutzen (z.B. systematisch probieren),
- Zusammenhänge erkennen, nutzen und auf ähnliche Sachverhalte übertragen.
Zahlen und Operationen
- Zahldarstellungen und Zahlbeziehungen verstehen
- Rechenoperationen verstehen und beherrschen
Muster und Strukturen
- Gesetzmäßigkeiten erkennen, beschreiben und darstellen
- Gesetzmäßigkeiten in geometrischen und arithmetischen Mustern (z.B. in Zahlenfolgen oder strukturierten Aufgabenfolgen) erkennen, beschreiben und fortsetzen,
- arithmetische und geometrische Muster selbst entwickeln, systematisch verändern und beschreiben.
Andreas Grajek
Letzte Aktualisierung: 19. Oktober 2025